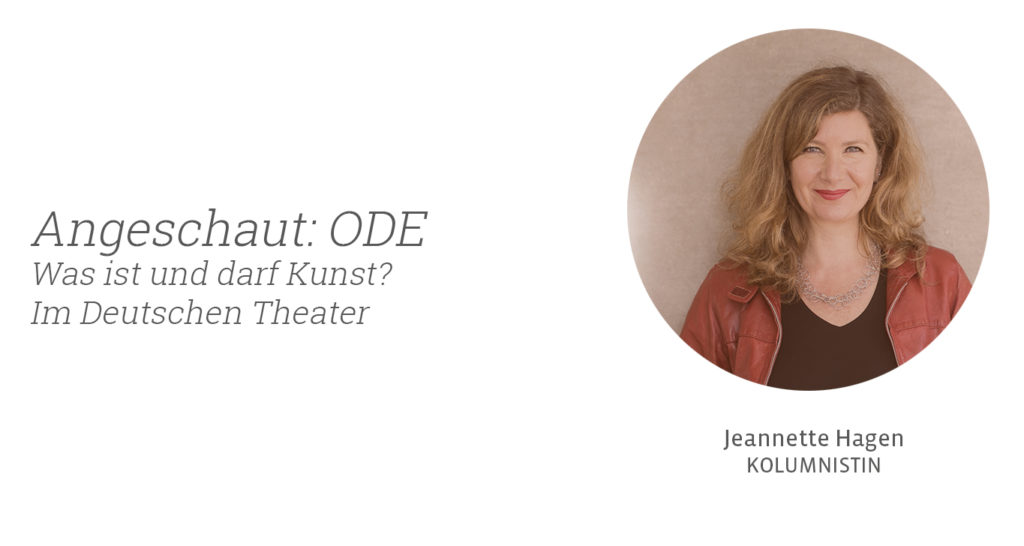Kolumne Jeannette Hagen, Kultur - was sonst noch passiert, Redaktion-Tipp
Angeschaut: „Ode“ im Deutschen Theater
In einem Interview sagte der Autor von „Ode“, Thomas Melle, er möchte, dass das Publikum nach der Vorstellung über das Stück diskutiert. Er meint, dass erst diese Diskussion das Stück komplett machen kann. Ich glaube nicht, dass das gelingt. Obwohl „Ode“ wirklich sehr gut gedacht und gespielt ist, scheitert es an diesem Anspruch. Ich glaube eher, dass diese Diskussion und damit auch das Stück niemals komplett sein werden, denn das wäre auch das Ende der Kunst.
Worum geht es? „Ode“ wirft Fragen auf, die sich allesamt rund um das, was Kunst ist und darf, drehen. Es beginnt damit, dass ein Kunstwerk enthüllt wird, dass zwar eine symbolträchtige und konfrontative Idee hat, die aber nichts darstellt. Man sieht nichts, man riecht nichts, man hört nichts. Warum? Weil da nichts ist. Aber ist es denn dann Kunst? Darf so etwas subventioniert werden? Und wer bestimmt, was Kunst ist? Der Betrachter? Die Künstlerin? Und darf es, wenn man dann schon nichts sieht, so eine provokante Idee haben? Hier prallen Haltungen aufeinander, fliegen den Zuschauern Argumente um die Ohren, werden die Zuschauer sogar im Chor beschimpft. Dieser Teil endet mit dem Tod der Künstlerin, die sich missverstanden fühlt und mit ihrem Freitod, gleich die nächsten Fragen aufwirft, denn was sie geschaffen hat, bleibt doch, selbst wenn sie nicht mehr da ist.
Im nächsten Akt, der nicht offensichtlich vom ersten getrennt ist, versucht sich ein Regisseur an der Geschichte von einst. Was ist passiert? Wie kam die Künstlerin dazu, das so zu inszenieren? Wie stellt man es dar und können andere überhaupt glaubhaft verkörpern oder bestenfalls nur interpretieren, was damals war? Auch hier, wie schon im ersten Teil erfolgen die Argumente dafür und dagegen, auch Angriffe auf die Kunst von allen Seiten. Die „Wehr“ bestimmt, wie etwas zu sein hat – egal ob sie von links oder rechts kommt. Erst im dritten Teil befreit sich die Kunst, geht lautstark gegen ihre Kritiker vor, wehrt sich, zeigt die Verblendung der anderen.
Und an der Stelle soll die Diskussion weitergehen. Das gelingt meines Erachtens nicht, denn man ist als Zuschauer nach zwei Stunden dieser sehr wortgewaltigen Inszenierung erschöpft. Das Wort ist auch zu flüchtig, als dass man es halten und weiterspinnen könnte. Was im Kopf bleibt, ist eine gute Aufführung, sind Bilder und der sehr schlüssige Anfang, der eine Geschichte erzählte, während die anderen zwei Teile eher wie Fragmente wirken, die immer wieder aufgerissen, neue Fragen aufwerfen. Vielleicht ist das aber auch genauso gewollt, denn das Stück kratzt damit auch an meiner eigenen Auffassung davon, was Kunst – in dem Fall Theater – erreichen kann oder soll oder eben auch nicht.
Wahrscheinlich erreicht es gerade jene nicht, die die Kunstfreiheit aktuell wieder einschränken wollen. Obwohl an sie gerichtet, wird es an deren Haltung nicht kratzen. Und dass ist die Crux. Es reicht nicht, wenn wir uns auf der intellektuellen Ebene mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sie müssen dorthin, wo die Wehr sitzt. Sie müssen aus den Theaterhäusern raus, von den Stufen runter und rein ins Volk. Das, was ich auf der Bühne gesehen habe, erreicht nicht „die Gesellschaft“, die angesprochen wird. Es erreicht eine Auswahl, ein wohlsituiertes Publikum, das vorab bei einem Getränk plaudert, hinterher in die Karossen steigt und die Fragen und die Not wahrscheinlich längst vergessen hat.
Nächste Termine: 5. und 17. März 2020
Karten und Infos: https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/ode-thomas-melle/

Auf dem Bild: Alexander Khuon, Natali Seelig